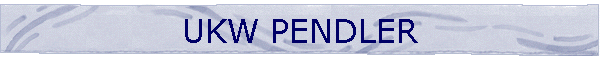
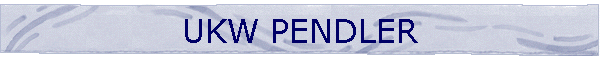
Der folgende Beitrag stammt von der Amateursenderschaltungen Rubrik aus Jogis Röhrenbude und ist hier wiedergegeben. Da gibt es noch etliche mehr UKW Sender und Empfänger Schaltungen.
An diejenigen, die an den Nachbau solcher Geräte interessiert sind, als obersten Grundsatz bitte unbedingt die einschlägigen Gesetze für den Bau und Betrieb von Sende und Empfangsanlagen der zuständigen Fernmeldebehörden beachten.
![]()


